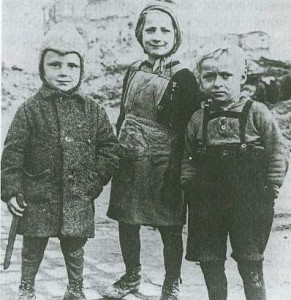Friedhof Lembeck: In der vorderen Reihe befinden sich die Gräber der bei der Explosion getöteten deutschen Soldaten; Foto: Wolf Stegemann
Von Wolf Stegemann
Wer den Kriegsgräberfriedhof in Lembeck besucht und durch die Reihen der steinernen Kreuze geht, wird verwundert lesen, dass neun deutsche Soldaten anderthalb Jahre nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs gefallen sind.
Die Kreuze sind mit Namen und Lebensdaten versehen: Kurt Menzel (21 Jahre), Heinz Lehwald (27), Gerhard Niehus (26), Alfons Goliasch (29), Alfred Walk (22), Günter Takas (26), Adolf Klostereit (21), Peter Koschwitz. (19), Heinz Fahrentholz (22). Alle Namen tragen dasselbe Sterbedatum: 23. Dezember 1946. Was geschah damals, einen Tag vor dem heiligen Abend? Weiterlesen